

Wolfgang Smy
Ich zeichne gern
Ich zeichne gern, wenn sich was bewegt, so bei Proben im Ballett, in der Arbeitswelt auf Baustellen
und Fabriken oder beim Sport.
Die Vielgestaltigkeit der menschlichen Bewegungen ist mir so interessant, dass ich einen Fundus
von Gesten in meinem Skizzendepot versammle.
Das Wesentliche einer erlebten Situation versuche ich dann beim Bildermachen spielerisch zum
Signet zu stilisieren. Durch aneinander Reihen, Stapeln, Schichten und Verknüpfen dieser Gesten
sollen Bildgeflechte auf der Leinwand entstehen, in denen alles agiert, drängt, handelt und arbeitet,
wie im Alltag unserer Tage – unablässig wirtschaftend.
Leinwandgevierte und Konstrukte aus Holz kleide ich neu ein und ernenne sie zum Bildobjekt.
Ich steuerte Pinsel und Druckstöcke zu Bildfindungen und durch die skandierende Wiederholung
von Bildelementen entstehen Werke, in denen sich der Geist unserer Tage spiegelt.
_____________________________________________________________________________________
Dr. Maren Kroneck
Wolfgang Smy schafft Sinn-Bilder
Wolfgang Smy schafft Sinn-Bilder für gesellschaftliches Zusammenleben:
Lebens-Bilder, in denen existentieller Kampf uns Überleben stattfindet. Berühmt geworden ist sein
giftgelbes „Stadtbad“ mit seinen Verhaltensstudien in Paar- und Konkurrenzsituationen. Oder er
reduziert Bildnisse zu Rasterköpfen gleich stereotypen Ornamenten. Er kreiert Mensch-Signets als gestikulierende Piktogramme und Bausteine für Vielfachprojektionen, formiert daraus Matrizen und
Schaltkreise oder nutzt sie als Stanzmuster für assoziationsreiche Musterteppiche.
Vorbild ist ihm dabei unsere zunehmend techniformere Welt, u. a. die Rasterfassaden in der
Architektur oder die Strukturen von Leiterplatten und Mikrochips, bald Wunderwerke an technischer
Perfektion, bald bedrohliche additive, uniforme Superordnung.
So sind sowohl Faszination als auch Beunruhigung Quellen für seine oft auf einen radikalen
Minimalismus reduzierten Schöpfungen.
_____________________________________________________________________________________
Ursula und Günter Feist
Das dritte und allergrößte der großen Badebilder, 1992 gemalt, bietet als Grund wiederum ein
tönendes Gelb. Die Zahl der Akteure verdoppelte sich gegenüber den vorherigen Bildern auf rund
60. Zur Gliederung dieser Menge hat der Künstler die Bildfläche segmentiert, wodurch Raumfelder
entstanden, in die sich die Figuren einzupassen haben und über deren Grenzen sie nur da und dort
übergreifend hinweggehen dürfen. ...
Smy selber nennt sein – fast schon monumentales – Werk ein „Unterhaltungs-Magazin“. Es soll nach
seinem Willen mit immer neu zu Entdeckendem aufwarten, ob dies nun die Ausdrucks-Ebene der
Mitteilung einer psychologischen Befindlichkeit oder die gestalterische Ebene des Aufrisses eines
Gesichts betrifft oder einfach nur das sinnliche Erfahren eines Wangentons. Die umfängliche
Bildergeschichte mit Comicanklängen hat in der Tat ganz im Sinne der vom Künstler beschworenen
Unterhaltung etwas Überquellendes, das den Betrachter weiterhetzt und ihn nirgendwo Halt und Ruhe
finden läßt. Wie bei den offensichtlicher formauflösend-technoiden Arbeiten Smy´s, von denen die
Rede war, ist sie auch hier zu konstatieren, die Verbindung zur modernen Medienkunst, wie sie etwa
der Koreaner Nam June Paik betreibt mit seinen – durch ein die Form verblüffend umkehrendes Transparentmachen – permanent bewegen „Schichtenbildern“.
Wenn man dergleichen Zusammenhänge sieht oder auch auf die Nähe Smy´s zu den schon
genannten Roy Lichtenstein und Andy Warhol, ferner zu David Hockney oder aber auch Robert Longo
und schließlich zur Arte Cifra mit Francesco Clemente hinweist, darf man nicht vergessen, daß
Wolfgang Smy auch Vorbilder in der Kunstgeschichte hat. Man denke nur an die naive Erzählkunst
der vorromanischen Bildnerei, z. B. an die Figuren der Hildesheimer Bronzetür, deren drastische Gebärdensprache pantomimische Züge trägt.
Und noch eine letzte Verbindungslinie sei gezogen. In Bezug auf den Menschen, der nun einmal
mit den Artgenossen „im selben Boot sitzt“, oder im selben Bassin schwimmt, bietet Smy auf seine
Weise ein kleines Welttheater. Als eben ein solches hat Carl Orff das Grimmsche Märchen „Der Mond“
begriffen, darin das magische Himmels-Licht, das sich immer wieder zum vollen Rund vollendet, zum
Symbol für den die Menschen entzweienden ewigen Zankapfel wird. Unter den grafischen Arbeiten
von Smy findet sich eine bildliche Übersetzung der vom Künstler geschätzten Orffschen Mondschöpfung,
ganz in Rot gehalten, jener Farbe, in die der Leuchtkörper bei Orff sich verfärbt, da man ihn – auf Teilung
aus – verletzt.
Orff spricht vom „unsichtbaren Puppenspieler“, dessen Schatten „über das kleine Welttheater geht“.
Auch bei Smy verhalten sich die Figuren ähnlich Marionetten, wie durch geheime Fäden gelenkt.
Manch anderes noch könnte Smy mit dem Dichter-Komponisten verbinden, dessen Gefühl für die
Einheit von Sprachklang, Musik, Tanz, Geste, Bild und Raum man rühmt. Orff nutzt die elementaren
Formen eines dem Volksliedhaften zuneigenden, unter Einsatz vieler Schlagzeuginstrumente
rhythmisch kraftvoll zupackenden Musizierens und setzt auf die Wirkung einer holzschnittartigen, teils
floskelhaft-knappen, das Pantomimische zur Geltung bringenden Charakterisierung, Reihungen und Wiederholungen sind bei Orff anzutreffen, und keine geringere Rolle spielt der die vervielfacht Stimme bedeutende Chor, was alles zusammen wieder für jenes andere steht, worauf es Smy in seiner Kunst entschieden ankommt: das große Muster.
_____________________________________________________________________________________
Heinz Weißflog
Auszüge aus der Eröffnungsrede von Heinz Weißflog am 16. 9. 2011
Die klasische Zeichnung die mit Models bedruckte und mit dem Pinsel bemalte Leinwände
gehen im Werk des Dresdner Malers Wolfgang Smy seit ca. 20 Jahren Hand in Hand. Damals
machte er mit seinem skurrilen Badebild auf sich aufmerksam. Inzwischen hat sich viel in der
Kunst ereignet.
Wolfgang Smy braucht die Arbeit vor der Natur, um danach mit dem Linolschnitt Wesentliches
herauszuarbeiten, Models aus einfachen Formen und eine formelhaft aufgefasste Figur, die mit
kleinen oder großen Fundstücken unserer Industrie- und Abfallgesellschaft schließlich auf dem
Öldruck zusammengebracht werden. Auf Smy´s Bildern geht es zu wie in einem überfüllten
Supermarktregal, Überfluss, Normierung und Serienproduktion gleichermaßen als neue optische
Qualität aufnehmend und als Reihung von Figuren und alltäglichen Gebrauchsgegenständen ins
Gemälde umsetzend, folgt der Künstler den Bestrebungen der Pop Art, vielleicht auch des Comic.
Seine ornamentalen Bildteppiche regen dazu an, in den Bildkosmos des Künstlers spielerisch leicht
einzudringen. Smy ironisiert immer, aber er verletzt nicht. Seine Heiterkeit eignet sich mühelos das Formenreservoir der Moderne an, integriert Alltagswelt und Technik und macht aus ihr etwas Neues,
Eigenes. So manövriert er unter anderen seine Eindrücke von elektrischen Schaltkreisen und
Bahnoberleitungen in seine Bilder. Die fast karikaturistisch aufgefasste Figur kennt keine Böden
und Gründe, sondern schwebt frei vom Bildhimmel herab auf die Erde, wo wir stehen und schauen.
Diese Ausstellung ist dem Thema Musik gewidmet. Wolfgang Smy geht regelmäßig zu Konzerten und
Proben in die Dresdner Musikhochschule.
Die tagebuchartigen Aufzeichnungen seiner Eindrücke und Skizzen sind immer vom Klang und der
Atmosphäre im Zuschauerraum inspiriert.
In seiner jetzigen Malerei zur Musik steigt die als Note aufgefasste Figur über die vage Bildfläche
auf und ab in einer unhörbaren, aber sichtbaren himmlischen Melodie. Smy´s geflügeltes Wort über
seine Arbeit mit Musik lautet: „Ich höre meine Bilder“.
Mit der Farb- und Bleichstiftzeichnung vor Ort fängt Wolfgang Smy Realität ein. Die von ihm sorgfältig
datierten Blätter sind authentische Zeugen von Konzerten und Einzelauftritten.
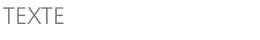
© Wolfgang Smy | Copyright 2026